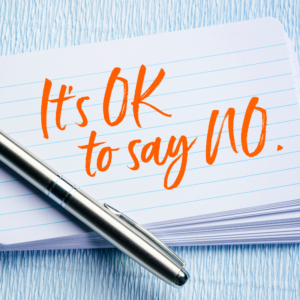
Bewusster „Nein“ sagen – klare Grenzen ziehen
Ein positives „Nein“ ist dein Erfolgsturbo. Entdecke, wie klare Grenzen dich stärken und dein Team zu mehr Eigenverantwortung inspirieren.


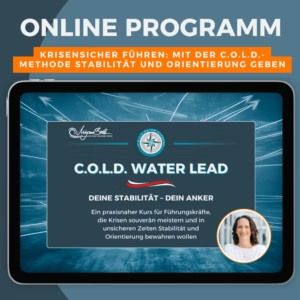

Turbulente Zeiten bringen mich zu Höchstleistungen. Sie sind mein Element. Egal, ob eiskalte oder kochende Gewässer, wo sich etwas bewegt oder schmilzt, lässt es sich neu formen. Dann ergeben sich Chancen, Dinge zu verbessern und schneller voranzukommen.

In jeder Transformation gibt es einen Moment, der so unscheinbar erscheint, dass er in kaum einem Projektplan Platz findet und dennoch entscheidend für die Qualität des Wandels ist. Die Strategieklausur liegt hinter dem Team, die Ziele wurden formuliert, die Gespräche voller Energie geführt und das Protokoll längst verteilt. Für einen Augenblick scheint alles möglich, doch sobald der Alltag zurückkehrt, mischt sich eine neue Atmosphäre in die Aufbruchsstimmung: Ein leises Zögern, Müdigkeit, irritierte Blicke und Gespräche, die nicht mehr so offen geführt werden wie noch vor wenigen Tagen.
Ich habe diese Phase immer wieder erlebt – als Teil eines Teams, als externe Begleiterin und als Führungskraft selbst. Sie tritt nicht mit Ansage ein, sondern schleicht sich wie Nebel am frühen Morgen heran, der die klare Sicht verschluckt und eine trübe Zone zwischen Erwartungen und Realität aufzieht. In solchen Momenten fallen Sätze wie „Wir müssen erst einmal abwarten“ oder „Mal sehen, was wirklich umgesetzt wird“, während die Atmosphäre allmählich zu einem Zustand verdichtet, in dem weniger gesagt wird, als gedacht.
Genau hier beginnt Führungsarbeit in ihrem eigentlichen Sinn: Nicht dort, wo Ziele glänzend präsentiert oder Strategien verkündet werden, sondern dort, wo der Enthusiasmus des Aufbruchs sich wandelt – subtiler, vorsichtiger und von neuen Fragen durchzogen.
In dieser Übergangsphase verändert sich der Ton hörbar, auch wenn kaum jemand dies offen anspricht. Aus anfänglicher Zustimmung wird vorsichtiges Schweigen, aus freudiger Beteiligung reservierte Beobachtung und die einst so spürbare Neugier beginnt zu bröckeln, überlagert von den bekannten Anforderungen des Alltags und den ersten Anzeichen von Erschöpfung.
Führung steht in diesem Moment unter genauer Beobachtung – nicht ihre Worte sind entscheidend, sondern ihr Verhalten, ihre Präsenz und ihre Fähigkeit, Orientierung zu geben, auch wenn diese nicht klar erscheint. Die eigentliche Frage lautet: Werden Spannungen wahrgenommen und aufgenommen? Haben Fragen Raum, oder gilt jede Form von Unruhe plötzlich als Störung?
Hier stoßen klassische Change-Programme an ihre Grenzen, denn Prozesspläne, Zielkennzahlen und Kommunikationsstrategien sind zwar sinnvoll, reichen jedoch nicht aus, wenn sich die emotionale Architektur des Wandels offenbart. Diese folgt keinem linearen Verlauf, sondern verläuft mitschwingend zwischen Rückzug, Verunsicherung und Infragestellung. Transformation bedeutet, über Strategie hinaus Beziehungen zu gestalten. Führungskraft und Team begegnen sich daher in einem Raum, in dem Unsicherheit bewusst angenommen wird.
Jeder tiefgreifende Veränderungsprozess kennt einen Moment, der selten Eingang in Strategiepapiere findet und doch über Erfolg oder Scheitern entscheidet. Kotters 8-Stufen-Modell beschreibt diese Phase zwischen ersten sichtbaren Erfolgen und der nachhaltigen Verankerung einer neuen Kultur als kritische Übergangszone.
In diesem Abschnitt scheint der Wandel abgeschlossen: Ergebnisse liegen vor, Teams arbeiten an neuen Prozessen, vieles deutet auf Stabilisierung hin. Doch diese Wahrnehmung täuscht. Die Organisation beginnt zu ermüden, während Führungskräfte versucht sind, Entschleunigung als Erfolg zu interpretieren.
Oft reagieren Organisationen reflexhaft mit zusätzlichen Meetings, feineren Projektplänen und weiteren Initiativen. Diese Aktivitäten wirken auf den ersten Blick als Zeichen von Sorgfalt und Aufmerksamkeit, lenken jedoch häufig von dem ab, was jetzt wirklich erforderlich wäre. Geschwindigkeit, Struktur und Programme allein genügen nicht, denn hier bewährt sich nicht die Rationalität des Plans, sondern die emotionale Qualität der Beziehung zwischen Führung und Team.
Menschen beobachten ihre Führung in dieser Phase sehr genau. Sie prüfen weniger die Inhalte von Programmen als die Haltung, mit der ihnen begegnet wird. Bleibt Führung präsent, auch wenn die Unsicherheit wächst? Besteht die Bereitschaft, Fragen zuzulassen, auch wenn diese unbequem wirken? Vertrauen entsteht durch spürbare Zugewandtheit und Präsenz gerade dann, wenn weder Kurs noch Stabilität gesichert erscheinen.
Was von Führung verlangt wird, bleibt oft verborgen: Den Mut, Verlangsamung nicht als Stillstand zu deuten, sondern als Ausdruck von Respekt vor der Komplexität der Situation. Diese bewusste Entschleunigung signalisiert, dass Unsicherheit Teil des Prozesses bleibt und genau diese Anerkennung stärkt das Vertrauen.
Zugleich offenbart sich an diesem kritischen Wendepunkt ein unterschätzter Denkfehler: Organisationen neigen dazu, Komplexität schnell reduzieren zu wollen, bevor sie sie wirklich verstanden haben. Diese Phase fordert jedoch etwas anderes: Aufmerksamkeit für Zwischentöne, Geduld für Ambivalenz und die Fähigkeit, Unsicherheit bewusst sichtbar zu halten.
Führung muss hier nah dran sein, Haltung zeigen, nicht nur Struktur bieten. Sie bedeutet Orientierung zu geben, ohne vorschnelle Antworten zu liefern und Raum zu schaffen für das, was zwischen Fortschritt und Zweifel entsteht. In dieser Haltung liegt der eigentliche Prüfstein von Führung: Nicht die Fähigkeit, Entscheidungen schnell zu treffen, sondern die Kunst, die Organisation durch eine Phase der Unschärfe zu begleiten, in der nichts endgültig ist und alles daher umso mehr Aufmerksamkeit verlangt.
Gerade in den unsicheren Phasen einer Transformation wächst die Bedeutung psychologischer Sicherheit – jenem Gefühl, dass Menschen sagen dürfen, was sie bewegt, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Diese Sicherheit entsteht nicht durch Programme oder Kommunikationspläne, sondern durch die Haltung der Führung: Durch echtes Zuhören, aufrichtiges Wahrnehmen und die Bereitschaft, auch unbequeme Wahrheiten auszuhalten.
Teams spüren genau, ob Führung ernsthaft zuhört oder nur Toleranz simuliert. Fragen wie „Was bremst uns gerade?“ entfalten nur dann Wirkung, wenn sie aufrichtig gestellt werden und Raum für ehrliche Antworten lassen. Diese Offenheit schafft einen Resonanzraum, in dem Vertrauen wächst und Wandel Tiefe erhält.
Führung in dieser Zeit erfordert nicht den Mut, sofort zu handeln, sondern den Mut, im Unvollständigen zu bleiben. Gerade diese Haltung gibt Orientierung, weil sichtbar wird, dass jede Stimme zählt.
Ich erinnere mich an ein Unternehmen, das ein großes Restrukturierungsprojekt mit großer Energie startete. Workshops, offene Diskussionsforen und kreative Impulse prägten die Atmosphäre, die von intensiver Neugier getragen war. Doch wenige Wochen der Umsetzungsphase veränderte sich das Bild: Meetings wurden kürzer und schwerfälliger, Rückmeldungen oberflächlicher und Gespräche drehten sich mehr um organisatorische Fragen als um Sinn. Erste Stimmen in den Teams bezeichneten die Initiative als „verpufft“, während die Führungskraft spürte, dass die anfängliche Begeisterung nicht mehr trug.
Die entscheidende Wende gelang nicht durch neue Maßnahmen, sondern durch einen bewussten Schritt zurück. Statt weitere Formate einzuführen, stellte die Projektleitung eine einzige Frage in den Raum: „Was bewegt euch gerade im Alltag dieses Wandels?“ Diese Frage war keine rhetorische Floskel. Sie war eine Einladung zur offenen Reflexion – ehrlich und mit echtem Interesse gestellt.
Die Wirkung dieses Moments lag nicht allein in der Frage, sondern in der Art, wie sie gestellt wurde: Langsam, präsent und mit einer Haltung, die zeigte, dass jedes Feedback willkommen war – nicht nur die positiven Rückmeldungen. Nach und nach veränderte sich der Raum. Stimmen, die zuvor geschwiegen hatten, meldeten sich zu Wort. Zurückgehaltene Kritik bekam Raum, während die Führung aufhörte, erklären zu wollen und begann, wirklich zuzuhören.
Dieser Moment wirkte positiv, weil er Verlangsamung und Aufmerksamkeit zusammenbrachte. Er signalisierte, dass der Prozess nicht beschleunigt werden musste, sondern verstanden werden wollte. Diese Begegnung auf Augenhöhe veränderte mehr als jeder neue Maßnahmenplan es vermocht hätte.
Teams spüren genau, wann ihre Wahrnehmung ernst genommen wird. Diese Ernsthaftigkeit schafft Vertrauen, bevor Ergebnisse entstehen und genau dieses Vertrauen trägt Wandel über die kritischen Schwellen hinweg.
Jede Transformation folgt nicht der klaren Logik von Ursache und Wirkung, sondern entfaltet sich in Mustern, die schwer vorhersehbar bleiben. Modelle wie die Veränderungskurve von Virginia Satir oder die Change-Kurve von Elisabeth Kübler-Ross zeigen anschaulich, dass Veränderungen eine Phase innerer Instabilität durchlaufen – Momente, in denen alte Gewissheiten verloren gehen, während neue Strukturen noch nicht tragfähig sind.
Diese Zwischenphase wirkt für viele Führungskräfte wie eine Krise, ist jedoch ein notwendiges Durchgangsstadium, ein emotionaler Raum, der völlig normal ist und nicht unterschätzt werden darf.
Frustration, Rückzug und Widerstand erscheinen in dieser Phase nicht als Störungen am Rand des Prozesses, sie sind vielmehr deutliche Signale seines Verlaufs.
Hier liegt die Herausforderung und zugleich die Chance für Führung: Widerstand nicht als etwas zu Überwindendes zu begreifen, sondern als Ausdruck von Verarbeitung. Wer genau hinhört, erkennt im Widerstand kein einfaches Nein, sondern oft ein Noch-nicht.
Die entscheidenden Fragen konzentrieren sich darauf, welche Aspekte des Wandels noch nicht verstanden oder emotional verarbeitet wurden und wo Unsicherheit entsteht, weil Erwartungen und Realität auseinanderdriften.
Führung gewinnt in diesem Stadium ihre größte Bedeutung nicht durch Programme, sondern durch Haltung. Vertrauen entsteht genau dort, wo Führung sichtbar macht, dass diese Phase dazugehört und Instabilität anerkannt werden darf.
Sobald Führung aufhört, Widerstand als Problem zu sehen und beginnt, ihn als Spiegel innerer Bewegung zu verstehen, öffnet sich ein neuer Raum – ein Raum für Entwicklung, der weit über Methoden hinausgeht, weil er die emotionale Architektur des Wandels anerkennt.
Führung steht in kritischen Phasen des Wandels vor einer paradoxen Aufgabe: Präsent zu bleiben, obwohl Orientierung nicht immer verfügbar ist.
Oft wird Durchhaltevermögen mit Tugenden wie Zähigkeit, verwechselt – als ginge es darum, gegen Widerstände „durchzukommen“. Echter Wandel verlangt jedoch etwas anderes: Bewusstheit.
Denn Durchhalten bedeutet nicht, sich durchzubeißen oder Beschleunigung zu erzwingen, sondern präsent zu bleiben, Unsicherheit auszuhalten und die eigene Handlungsfähigkeit immer wieder in Bezug zur Situation zu prüfen.
Diese Haltung erfordert von Führungskräften, das Gleichgewicht zu wahren zwischen Reflexion und Aktion, Zuhören und Entscheiden, Innehalten und Weitertragen.
Ein oft übersehener Aspekt besteht darin, dass Führung in dieser Phase auch den eigenen Anteil an Blockaden erkennen muss – etwa den Wunsch nach Kontrolle, die Sehnsucht nach Tempo oder das Bedürfnis nach Anerkennung für Fortschritt.
Widerstand existiert nicht nur im Team oder der Organisation, sie existiert auch in den Erwartungen und Ängsten der Führung selbst. Wer Durchhalten als bewusste Praxis versteht, erkennt diese inneren Muster, justiert Erwartungen neu und erlaubt sich, Dauer und Tiefe des Prozesses anzunehmen.
Am Ende zählt nicht, was auf den Präsentationsfolien stand. Was bleibt, sind Erfahrungen: War Führung sichtbar, auch als die Begeisterung nachließ? Wurden Gespräche geführt, selbst wenn sie anstrengend oder unbequem waren? Hatten Fragen Raum, auch wenn sie nicht sofort beantwortet werden konnten?
Diese Erlebnisse prägen die Qualität eines Wandels. Sie schaffen Erinnerung und Vertrauen – nicht weil alles perfekt verlief, sondern weil Führung in entscheidenden Momenten präsent blieb.
Die eigentliche Frage lautet daher: Wurden Menschen gesehen? Wurden sie ernst genommen? War das Vorhaben ein Projekt mit definiertem Anfang und Ende oder entwickelte es sich zu einer gemeinsamen Bewegung?
Führung hinterlässt dort Spuren, wo Menschen sich an ihre Wahrnehmungen, Zweifel und Hoffnungen erinnert fühlen. Genau das bleibt, nicht als Strategiepapier, sondern als gelebte Erfahrung. Und diese Erfahrung entscheidet darüber, ob die Organisation am Ende nur neue Prozesse einführt oder als Kollektiv gewachsen ist.
Wenn Veränderung ins Stocken gerät und Gewissheiten verschwinden, entsteht Raum für Präsenz Wenn Veränderung ins Stocken gerät, entsteht kein Scheitern, sondern ein Raum: für Innehalten, für Fragen, für neues Vertrauen. Genau hier entscheidet sich, ob Führung präsent bleibt – auch ohne klare Richtung.
In meiner Arbeit begleite ich Menschen in solchen Momenten: dort, wo Unsicherheit aushalten, Zuhören und Vertrauen wichtiger sind als Tempo oder Pläne.
Führung bedeutet dann nicht, Antworten vorzugeben, sondern Orientierung zu schaffen, während der Weg sich erst entfaltet.
📬 C.O.L.D. Water News abonnieren.
Monatliche Inspiration und praktische Strategien für deine (Selbst-)Führung in turbulenten Zeiten
🤝 Gratis Kennenlerngespräch
Lass uns herausfinden, wie ich dich und dein Team am besten unterstützen kann.
Herzlich,
Mirjam
Dann empfehle ich dir folgende Blogartikel:
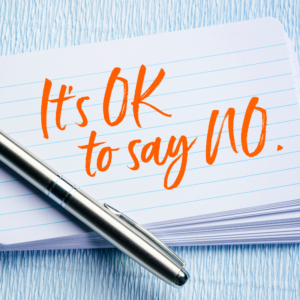
Ein positives „Nein“ ist dein Erfolgsturbo. Entdecke, wie klare Grenzen dich stärken und dein Team zu mehr Eigenverantwortung inspirieren.

Das Zusammenspiel von Führungsautorität und Vertrauen wird schnell zum Drahtseilakt. So findest du die richtige Balance.

Vertrauen ist ein Grundpfeiler des Miteinanders und die Essenz der Führung. Wie lässt sich gefährlicher Vertrauensverlust verhindern?
Du willst wissen, wie du Rückschläge leichter überwindest?
Du willst die Entstehungsgeschichte des Erfolgstools „C.O.L.D. Water Kompass“ genauer kennenlernen?
Dann hol dir hier meinen Kompakt-Ratgeber „Rote Karte für Rückschläge“.
Finde in nur 3 Minuten heraus, welches Programm dich stärkt.